Achtundfünfzig Tage „zu viel“ verbrachte Olga Kosanović im Ausland. Darunter waren einige Verwandtenbesuche in Serbien, aber vor allem viel Zeit in Deutschland. Ein Auslandsstudium. Schon lange keine Kuriosität mehr für eine Europäerin. Es sei denn, sie möchte die österreichische Staatsbürgerschaft erlangen. Da kann die sonst für junge Menschen hochgelobte Bildung und Lebenserfahrung jenseits der Grenzen schon mal zum Fallstrick werden.
Der Antrag der in Korneuburg geborenen und in Wien aufgewachsenen Filmemacherin mit serbischen Wurzeln wird abgelehnt. Mit Mitte 20 findet sich die Wienerin in einem Informationsabend wieder, wo sie aus dem Staunen nicht herauskommt: „Wirklich aufpassen bei den Strafen. Wenn Sie ein Auto haben: am besten abmelden und drei Jahre stehen lassen“, hört sie den Vortragenden ironisch sagen. Die Kriterien, um hier eingebürgert zu werden, sind so restriktiv, dass Österreich international nur noch von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten überholt wird, weiß Gerd Valchars, Experte für Staatsbürgerschaftsrecht.
Olga Kosanović wollte endlich offiziell dazugehören und wählen gehen dürfen. Die Devise lautete aber vor gut fünf Jahren: Zurück an den Start.
Ihr erster Langfilm hätte gut ein wütender Rachefeldzug werden können. Vermutlich hätten die meisten, die ihre Geschichte hören, sogar Verständnis dafür gezeigt. Die mehrfach preisgekrönte Filmschaffende wählte aber einen ganz anderen Weg: „Noch lange keine Lipizzaner“ wurde ein kluger, mitreißender und gleichsam hinreißender Kinofilm, für den Olga Kosanović mit ihrem Team die Essenz aus rund 50 Gesprächen mit Menschen „von der Straße“ und Expert*innen mit humorvollen, animierten und ästhetisch anspruchsvollen, szenischen Sequenzen verwob. In die Liste der Stargäste reihen sich etwa TikTokerin und Satirikerin Toxische Pommes sowie Autor Robert Menasse ein.
Olga Kosanović: Ich konnte es selbst nicht glauben, als ich mich einbürgern lassen wollte, obwohl ich in Österreich geboren wurde und außer zu meinem Studium immer in Wien gelebt habe. Bis zur Entscheidung, einen Film daraus zu machen, war es trotzdem eine lange Reise. Der Initialmoment war, als ich eine SOS Mitmensch-Kampagne mit einem Video unterstützt habe, in dem ich meine Geschichte erzählt habe, und das völlig ungeplant viral ging. Plötzlich waren da Interviews, Artikel und Tausende Kommentare in verschiedenen Foren – und ich habe mich gefragt: Warum interessiert das so viele Menschen? Welche Emotionen spüren sie dabei – sowohl die Österreicher*innen als auch die Nicht-Eingebürgerten? Ich hatte das Gefühl, alle haben etwas dazu zu sagen, ohne eine Ahnung zu haben, wie auch ich davor. Diese vielen Reaktionen haben mich überrascht.
Eine Aussage hat mich besonders aufgewühlt: auf witzige, absurde und abscheuliche Weise. Ein Forum-User hat geschrieben: „Wenn eine Katze in der Hofreitschule Junge wirft, sind das noch lange keine Lipizzaner.“ – „Noch lange keine Lipizzaner“ wurde unser Arbeitstitel, aber wir haben ihn schließlich nie verändert.
Ich habe mich das erste Mal in meinem Leben richtig fremd gefühlt. Davor war ich immer eine Wienerin, mir war wurscht, was auf meinem Reisepass steht. Plötzlich erfuhr ich Ablehnung, las abschätzige Kommentare, die ich auch alle gespeichert habe, weil ich es nicht anders fassen konnte. All dem so ausgesetzt zu sein, war natürlich auch kränkend. Trotzdem ist mir wichtig zu betonen, dass der Film nicht aus einer Kränkung heraus entstand. Ich möchte viel mehr alle einladen, darüber nachzudenken und darüber zu reden, was die Einbürgerung in Österreich bedeutet. Ich selbst war ja davor völlig blauäugig, ich war mir sicher, dass es in meiner Situation funktionieren muss.

Ich bin ein Beispiel für viele, viele Kinder, die in Österreich geboren sind, ausländische Eltern haben und mit beiden Identitäten und in beiden Realitäten aufwachsen.
Weil ich hier zuhause bin. Selbst als ich in Hamburg studiert habe, war mir immer klar, dass ich wieder nach Wien zurück möchte, dass dort mein Lebensmittelpunkt ist. Und ebendort möchte ich mitbestimmen dürfen. Ich möchte wählen gehen. Ich war politisch involviert, hatte aber kein Stimmrecht – ich bin jetzt 30, ich will das so nicht mehr. Das hat mich immer gestört.
Und es gab auch Situationen, wo ich mit meinem serbischen Pass benachteiligt war: beispielsweise bei Stipendien oder der Reisefreiheit. Einmal musste ich vom Flughafen wieder nach Hause fahren, während meine Freunde nach London geflogen sind, weil mir zuvor nicht bewusst war, dass ich extra ein Visum gebraucht hätte. Es war zwar ein Stück Papier, trotzdem hat es mir Steine in den Weg gelegt. Dabei bin ich in Serbien Ausländerin, ich habe dort nie gelebt. Ich wollte mich um meine Einbürgerung kümmern, wenn ich unabhängig bin, wenn ich es mir selbst leisten und organisieren kann und nicht meine Eltern irgendwelche Lohnzettel heraussuchen müssen. Als ich dann aber mit dem Studium fertig war, war es wie „zu spät“, weil ich eben davor viel im Ausland war.
Auch das tauchte erst später auf, parallel mit den „neuen“ populistischen Strömungen in Europa. Es begann während Corona, als der Bundeskanzler (Sebastian Kurz, Anm.) seine Reden immer wieder explizit an die Österreicherinnen und Österreicher richtete. Anfangs wusste niemand, was kommen wird. Ich bin damals mit meinem Mann auf dem Sofa gesessen – ich bin mit einem Österreicher verheiratet – und habe gesagt: Stell dir vor, es wird entschieden, dass alle, die die Staatsbürgerschaft nicht haben, in ihr Land zurückmüssen. Solche Sorgen kamen seither doch immer wieder. Ich fühlte mich nicht mehr ganz safe.
Absolut nicht. Ich bin ein Beispiel für viele, viele Kinder, die in Österreich geboren sind, ausländische Eltern haben und mit beiden Identitäten und in beiden Realitäten aufwachsen. Das ist ein Phänomen, das in Österreich durch die Zuwanderung seit mindestens den 1960er Jahren vorherrscht, aber mit dem Einbürgerungsgesetz, sich für das eine oder das andere entscheiden zu müssen, vollkommen negiert wird.
Das bedeutet, dass man etwas zurückgeben muss, womit die eigene Familiengeschichte verbunden ist. Autochthone Österreicher*innen finden oft, das würde bedeuten: Wenn sie nicht ganz zu uns stehen kann, spürt sie uns emotional nicht. Ich bin aber davon überzeugt, dass man beides in sich haben kann. Sogar mehrere Identitäten, ohne dass sich das irgendwie beißt.
Genau, und dass man sich dieses Gefühl erarbeiten muss, finde ich ein bisschen unfair. Ich würde mir sehr wünschen, dass es in unserer Gesellschaft ankommt, dass Mehrsprachigkeit und mehrfache Identität für alle eine Bereicherung ist. Ich selbst habe meine serbische Identität oft „weggedrängt“, manchmal habe ich sogar erfunden, dass ich gar kein Serbisch spreche, um ja nicht nicht dazuzugehören. Es dauert lang, bis man das Selbstvertrauen dafür entwickelt, bis man checkt, dass das super ist.
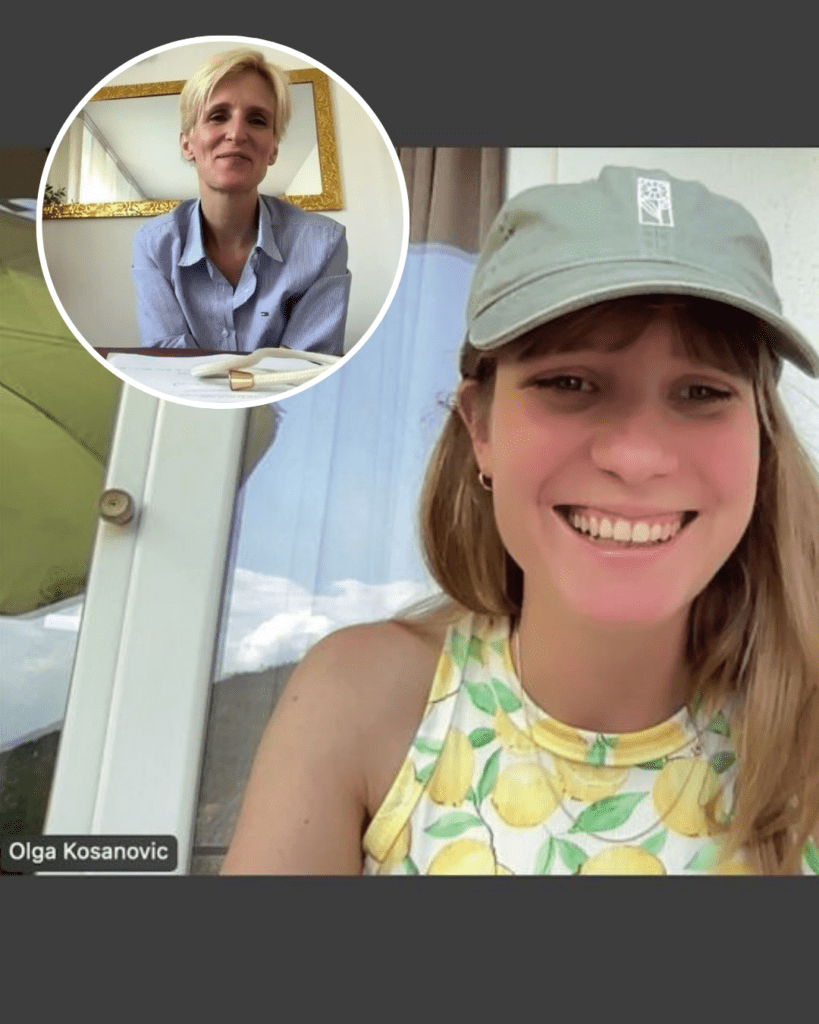
Man hat auch am Filmende kein Einmaleins, nicht die eine Lösung, wie es zu machen ist. Mir ist am wichtigsten, dass man anfängt nachzudenken: Sind diese Gesetze noch zeitgemäß? Passen die noch zu unserer Gesellschaft?
Dieser Katalog an Kriterien, die es in Österreich zu erfüllen gilt, ist sehr umfangreich. Selbst eben für Menschen, die hier geboren wurden. Was ich sofort ändern würde, ist, dass es gehaltsabhängig ist. Ich finde das demokratiepolitisch nicht richtig, dass nur Leute eingebürgert werden, die gut genug verdienen. Ein zweites absurdes Kriterium betrifft die Verwaltungsstrafen. Ein Leumundszeugnis ist schon okay, aber dass man anfängt, Parkstrafen zu zählen?! Was sagt das über einen Menschen aus?
Es war für uns eine ganz zentrale Frage in der Recherche, dass die autochthonen Österreicher*innen verstehen: Dieses Thema betrifft wirklich alle. Judith Kohlenberger erklärt sehr gut, was es bedeutet, wenn mehr als ein Drittel der Menschen in Wien nicht wählen kann: nämlich, dass die Stimmen von autochthonen Österreicher*innen in Wien damit prinzipiell weniger wert sind.
Das verkürzte Urteil vieler lautet oft: Dann haben wir zu viele Ausländer*innen in Wien. Leider, genau das ist das Problem, deswegen ist es auch politisch ein so unbeliebtes Thema, weil es sofort populistisch aufgegriffen wird.
Dabei denken trotzdem viele intuitiv: Wenn jemand viele Jahre in Österreich lebt, arbeitet, Steuern zahlt, darf die Person doch auch wählen gehen – das stimmt aber eben nicht. Wir haben viele, viele Interviews gemacht, auch mit Menschen älteren Semesters, und wir sind auch in Bars gegangen, wo wir sozusagen unsere Bubbles verlassen haben. Mit allen, die sich wirklich darauf eingelassen haben, konnten wir tolle, sehr interessante Gespräche führen. Die Menschen konnten offen ihre Meinung sagen – und es bröckelten auch viele Fassaden-Glaubenssätze.
Mein Akt wurde an das Verwaltungsgericht weitergegeben, nachdem ich mit einem Anwalt Säumnisbeschwerde eingereicht hatte. Ich bekam dann eine Gerichtsladung – und sollte noch einmal meine sämtlichen Kontoauszüge der vergangenen fünf Jahre einreichen. Das ist schon arg, da sieht man wirklich alles, noch dazu, wenn man wie ich alles mit Karte bezahlt. Der Termin war dann nach acht Minuten vorbei – und ich habe vom Richter die Zusicherung für die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen. Das ist für zwei Jahre gültig. Ich muss nun die serbische Staatsbürgerschaft zurücklegen, das ist auch nicht lustig und kostet noch viel Geld. Und ich muss bis zum Tag der Verleihung weiterhin alle Kriterien aufrechterhalten – ebenso die Verwaltungsstraffreiheit.
Dieser Tag am Gericht war absurd. Es hat irrsinnig geschüttet und mein Mann und ein Freund, der auch mit war, und ich sind dann einen Punschkrapfen essen gegangen, um diesen Tag doch speziell zu begehen. Als ich nach dem Gerichtstermin heimgekommen bin, bin ich sofort eingeschlafen, das passiert mir sonst nie. Aber ich war plötzlich so erschöpft. Da war nun etwas erledigt, das fünf Jahre meines Lebens, mal mehr, mal weniger in Anspruch genommen hatte. – Ja, wenn es soweit ist, wenn es eine Verleihung gibt, werden wir feiern (lacht).
Olga Kosanović wurde am 1. April 1995 in Österreich geboren und lebt in Wien. Sie studierte an der HFBK Hamburg und arbeitet heute als Regisseurin und Drehbuchautorin sowie als Lehrkraft an der Graphischen und der Hertha Firnberg Schule in Wien. Ihre Filme liefen auf zahlreichen Festivals und sind mehrfach preisgekrönt; dazu zählen der Kurzfilm Genosse Tito, ich erbe sowie Land der Berg, der u. a. kürzlich mit dem Österreichischen Filmpreis, dem Preis für den besten Nachwuchsfilm bei der Diagonale und mit gleich zwei Preisen beim Filmfestival Max Ophüls Preis ausgezeichnet wurde. Noch lange keine Lipizzaner ist ihr erster Langfilm; Kinostart: 12. September 2025.
Buchtipps:
- Judith Kohlenberger: Wir (2021, Kremayr & Scheriau) und demnächst: Migrationspanik – Wie Abschottungspolitik die autoritäre Wende befördert (Picus Verlag, erscheint am 10. September)
- Toxische Pommes: Ein schönes Ausländerkind (2024, Zsolnay Verlag)
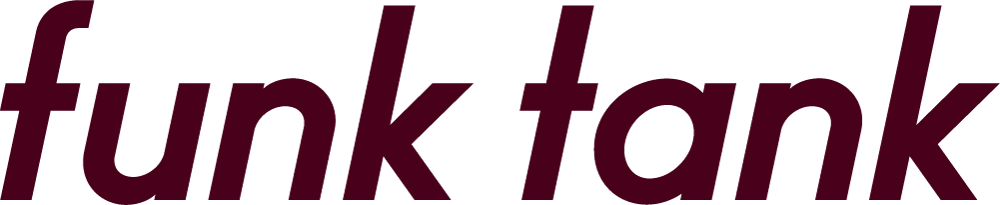











Noch kein Kommentar, Füge deine Stimme unten hinzu!