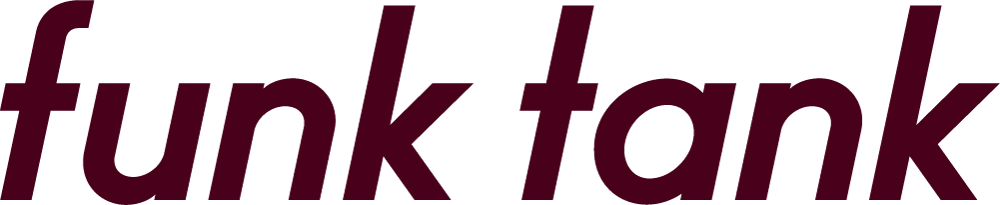Die „Pratersterne“ sind zurück. Gingen viele davon aus, dass die 2017 erstmals on Air gegangene ORF-Sendung nach der vergangenen Staffel eingestellt wurde, gibt es jetzt doch ein Wiedersehen mit Moderator Hosea Ratschiller und dem vielversprechendsten Kabarettnachwuchs des Landes. Und das in einer neuen Umgebung. Denn das „sehr räudige“ (Zitat Hosea Ratschiller) Fluc am Wiener Praterstern, das der Sendung ursprünglich den Namen mitgegeben hat, wurde gegen das noble Ambiente der Roten Bar im Volkstheater eingetauscht. Zu sehen sind die neuen Folgen seit 7. Jänner im ORF. Wie sich der neue Spielort anfühlt, hat uns Hosea Ratschiller ebenso geschildert wie sein Verhältnis zu Social Media und zu Political Correctness.
Hosea Ratschiller: Ja, wir sind vom sehr räudigen Fluc am Praterstern, das aber eine sehr urbane Stimmung hatte und so eine Ausgeh-Atmosphäre, übersiedelt in die Marmorhallen des Volkstheaters. Ich glaube, die Idee dahinter, die „Pratersterne“ in die Rote Bar zu verpflanzen, war: Wir machen sozusagen einen Ausflug, und dann hat der Onkel mit der dicken Brieftasche uns eingeladen ins feine Restaurant, und wir ziehen uns das edelste Gewand an, das wir finden können. Es fühlt sich ein bisschen wie eine Mottoparty an.
Genau, wir erzählen trotzdem von unseren Dating-Unfällen und wo wir überall ausgerutscht sind, und was uns so alles auffällt. Es ist zwar rundherum Marmor, und an der Decke hängt ein Kristallluster, aber je länger wir da sitzen, desto wohler fühlen wir uns und denken nicht mehr darüber nach, welche jetzt die Fischgabel ist. Jetzt ist die Frage, wie das Fernsehpublikum diesen Wechsel annimmt.
Ich glaube, es wird schon einen Unterschied machen. Aber die Bilder sind so schön – es wirkt fast wie ein Fiebertraum von Arthur Schnitzler. Es ist eine andere Seite von Wien, die wir da jetzt zeigen, das Großbürgertum.
Zumindest gehen wir da hin und zeigen uns – aber auf Einladung, das möchte ich schon betonen. Wir sind keine Hausbesetzer, sondern wir kommen einer Einladung nach, benehmen uns dann aber daneben.
Wir waren sehr zufrieden im Fluc, es hatte eine tolle Atmosphäre. Es hat alle Beteiligten inklusive mich selbst sehr überrascht, wie dankbar auch ein Publikum, das sonst nie in ein solches Lokal gehen würde, uns dorthin gerne gefolgt ist. Wir fühlen uns aber in der Roten Bar auch sehr wohl. Es ist nur eine andere Art von Ausgehen. Es ist mehr Maturaball als Freitagabend-Fortgehen.
Ja. Aufmerksame Zuseher*innen werden zum Beispiel erkennen, dass der eine Herr, der fast in jeder Sendung war, auch im Volkstheater wieder aufgetaucht ist. Das hat uns sehr gefreut.
Genau. Ob er der Klassenlehrer ist, wird sich erst herausstellen.
Das Coole ist, dass tatsächlich Leute, die vor ein paar Jahren bei uns als Neulinge aufgetreten sind, jetzt die Stars sind: Christoph Fritz, Malarina, Berni Wagner, die hatten alle bei uns ihren ersten TV-Auftritt – und jetzt sind sie unsere Headliner. Wir haben zwar nicht viel Geld zu verteilen, aber dafür Aufmerksamkeit, Fernsehzeit, den Rückhalt einer Redaktion, ein Publikum und – was man nicht unterschätzen darf – sendefähiges Material. Weil wir wirklich Top-Kameraleute und mit Jan Frankl einen absoluten Profi für den Schnitt haben. Diese Mannschaft bietet den Leuten, die da antreten, ideale Bedingungen, um auch selbst ein Material zu bekommen, das man dann überall hinschicken kann.

Das macht die Redaktion, und die macht das sehr gut. Ich mische mich nicht ein. Ich mache höchstens Vorschläge, aber ich habe von Anfang an gesagt: Ich möchte nicht darüber entscheiden, welche Kolleg*innen hier eine Plattform kriegen. Es ist nicht meine Sendung, ich bin nur der Moderator im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir haben alte Freunde, die zu uns kommen, obwohl sie das nicht müssten, wie Thomas Maurer, Gunkl oder Christoph & Lollo. Das freut uns sehr, und mindestens genauso freut uns, dass unsere Nachwuchsarbeit so gut funktioniert. Wir sind quasi das Salzburg des Kabaretts, wir haben die Talente schon, wenn sie ganz jung sind – und immer noch, wenn sie große Stars sind.
Zu Beginn haben wahrscheinlich viele Leute die „Pratersterne“ vor allem wegen Josef Hader, Andreas Vitásek, Alfred Dorfer, Roland Düringer, Thomas Stipsits, Klaus Eckel und all diesen Leuten geschaut. Mittlerweile schalten sie, glaube ich, wirklich wegen der Sendung selbst ein. Aber ich würde jeder humoristischen Sendung, wenn sie solche Stars bekommen kann, schwerstens empfehlen, ja zu sagen.
Bei uns wird es ganz schön viele neue Gesichter zu sehen geben. Vor allem musikalisch: Resi Reiner, Rahel, Endless Wellness – diese Namen hat ein breiteres Publikum bisher nicht allzu oft gehört. Aber die sind echt gut. Und Leute wie Ina Jovanovic oder Tereza Hossa, die schon in der Sendung waren, sind sehr jung, aber schon sehr weit fortgeschritten. Und Romeo Kaltenbrunner ist aus meiner Sicht nicht nur der schönste Kabarettist des Landes, sondern der hat es echt drauf, bist du deppat. Der ist zwar schon Mitte dreißig, aber immer noch neu.
Unser Anliegen bei den „Pratersternen“ war, zu zeigen, dass viele unterschiedliche Ansätze nebeneinander funktionieren können. Meine Lieblingssendung in der ersten Staffel war die, wo Thomas Stipsits und die damals noch undergroundige Stefanie Sargnagel hintereinander aufgetreten sind, und beide haben beim Publikum exakt gleich gut funktioniert und könnten unterschiedlicher nicht sein. Dass dann, wenn man das bewiesen hat, es diverser zugehen kann und auch die Entscheidungspersonen überzeugbar sind, dass man nicht immer dieselben fünfzehn, zwanzig Personen nehmen muss, darauf haben wir ein bisschen gewettet – und die Wette haben wir gewonnen. Und dass sich parallel dazu die Welt dahingehend verändert hat, dass es nicht mehr ungewöhnlich ist, dass eine Frau auf der Bühne steht und Witze erzählt, das spielt uns natürlich in die Hände. Wir waren immer offen dafür, Unterschiedliches nebeneinander abzubilden. Dass das so aufgeht, ist schön, und ich freue mich darüber. Aber unser Hauptanliegen bleibt, dass es lustig ist. Dass wir zeigen, was die österreichische Kabarettszene so hergibt. Und dass die so bunt und divers ist wie nie zuvor, ist einfach unser Glück.
Früher war man im Kulturbereich abhängig von einigen wenigen Personen, die Entscheidungen getroffen haben. Alles war sehr hierarchisch organisiert und stark männlich dominiert. Mittlerweile kann man sich online selber ein Publikum erspielen. Aber das auch nur, wenn man die Zeit dafür hat, den Erwerbsdruck nicht hat, um vier Stunden am Tag Social Media bespielen zu können. Ich behaupte: Als Alleinerzieherin hast du es da immer noch schwer. Als jemand, der sich in seinem Privatleben um andere kümmert, Rechnungen zu bezahlen hat, kein Erbe im Hintergrund hat, ist es nicht deutlich leichter geworden. Aber für Leute, die ungebunden sind und ihre ganze Lebenszeit und -energie in den Aufbau einer Instagram- oder Tiktok-Seite investieren können, gehen die Türen leichter auf als früher.
Natürlich, es muss einem auch liegen. Toxische Pommes hat in einem Interview gesagt, wenn du keine Lust darauf hast, kannst du es gleich bleiben lassen, weil das merkt man. Das ist ein bisschen das, worin ich gefangen bin – weil mir macht es keinen Spaß, Zwanzig-Sekunden-Videos zu machen. Ich habe A nicht die Zeit, B nicht die finanzielle Absicherung und C nicht die Lust daran. Hätte ich nicht drei Kinder und diesen Mental Load, müsste ich nicht die Miete zahlen, den Alltag meiner Familie organisieren, putzen, kochen und so weiter, vielleicht würde es mir Spaß machen. Und vielleicht hätte ich es früher als Zwanzigjähriger auch gemacht. Aber jetzt hab ich echt ein Problem, das gebe ich ehrlich zu. Ich muss versuchen, diese alten Formen gut genug zu bespielen und trotzdem ein Publikum anzusprechen, das nicht nur vor sich hin altert. Zum Glück gelingt das, und es sitzen bei mir nicht immer dieselben drin und altern mit mir, sondern es kommen auch Neue nach. Das schönste Feedback für mich ist, wenn Eltern ihre Kinder mitnehmen, dass es denen auch getaugt hat. Weil das bedeutet, dass ich diesen Beruf noch ein paar Jahre weitermachen darf. Aber ich bin darauf angewiesen, dass Leute ihrem Nachwuchs Tickets für meine Vorstellungen schenken.
Wir sind quasi das Salzburg des Kabaretts, wir haben die Talente schon, wenn sie ganz jung sind – und immer noch, wenn sie große Stars sind.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass diese Tradwifes, die das tun, in Wahrheit auch nur etwas verkaufen. Ich glaube, dass das Geschäftsfrauen sind, die damit ihre Familie ernähren, und dass da wer anderer den Haushalt macht. Dass du neben dem Aufbau einer Social-Media-Seite noch zusätzlich eine Familie ernähren kannst, halte ich für ausgeschlossen.
Es ist so, dass das dazukommt. Das ist ja nicht das Erste, was da ist, sondern dass du etwas in dir spürst, dass du gerne auf der Bühne stehst und weißt, wie man einen Witz macht, dass du dich da wohlfühlst und über den Stress hinaus, den das macht, auch andere Gefühle abzuholen sind; und dass du dich – was ich gar nicht unterschätzen würde – wohlfühlst mit anderen Leuten, die das Gleiche machen; dass du einer von ihnen sein willst. Das ist alles zuerst da. Dass das dann dein Beruf wird und der irgendwann dein Leben finanzieren muss, als jemand, der Kinder hat oder alte Leute in der Familie versorgen muss, das kommt ja dann alles erst und verdirbt dir nicht die Lust auf den Beruf. Es verdirbt dir vielleicht die Lust auf den Beruf und kostet dich die Geduld mit Leuten, die dir sagen, dass du das alles schaffen musst. Aber wenn ich herumfahre und auf Bühnen stehen darf, dann ist das die Belohnung. Der Drang auf die Bühne war bei mir so unausweichlich und schon als Kind da – ich habe echt versucht, daran vorbeizukommen, aber das war nicht drin. Meinen Eltern zuliebe, die die Ersten in der Familie mit einem Studium waren, habe ich tatsächlich versucht, einen anständigen Beruf zu lernen.
Ich wollte Jus studieren. Mein Vater hat mich einmal als Kind gefragt, was ich später machen will, und da habe ich geantwortet: Ich will fünfzigtausend Schilling verdienen (Anm. das entspräche heute in etwa 7.500 Euro) – womit, war mir wurscht. Ich wollte nur nicht so wenig Geld haben wie meine Eltern.
Das Problem ist eher, dass ich manchmal ernst sein muss. Damit kämpfe ich. Um ein verträgliches Mitglied der Gesellschaft zu sein, muss man irgendwann zumindest ein minimales Interesse an Dingen entwickeln, die nicht auf eine Pointe hinauslaufen. Das kostet mich wesentlich mehr Kraft, als lustig zu sein. Ich glaube, das ist ein Wesenszug: Wenn Kabarettist*innen miteinander sprechen, das könnte man auf der Bühne gar nicht bringen, weil wir wirklich über alles Witze machen, und das die ganze Zeit. Political Correctness ist zwar momentan ein großes Thema, aber in der Garderobe findet die nicht statt – und zwar in keiner.
Oja, aber es wird nicht einfacher, mit den Konsequenzen zu leben. Freilich nicht für alle, und da muss man wieder differenzieren. Aber ich halte dieses „Man darf heute nichts mehr sagen“ für völligen Stumpfsinn. Man darf heute mehr sagen als je zuvor – es sagen nur halt die anderen dann auch was.
Um ein verträgliches Mitglied der Gesellschaft zu sein, muss man irgendwann zumindest ein minimales Interesse an Dingen entwickeln, die nicht auf eine Pointe hinauslaufen. Das kostet mich wesentlich mehr Kraft, als lustig zu sein.
Nein. Aber weniger aus Sorge, dass ich irgendwelche Gefühle verletzen könnte, sondern aus einem handwerklichen Ehrgeiz heraus. Ich verwende keine Kraftausdrücke und keine Fäkalsprache auf der Bühne, weil ich mir nicht die billigen Pointen abholen will. Ich habe den seltsamen Ehrgeiz, der mir oft im Weg steht und mich bremst, es auch anders hinzukriegen.
Es ist an anderen Stellen für die Jugend dann schwieriger. Ich spreche die Dinge klar an, ich verwende nur eine cleane Sprache.
Hosea Ratschiller, Jahrgang 1981, wollte seinen Eltern zuliebe Jus studieren, hat letztlich aber ein Studium der Geschichte, Philosophie und Theaterwissenschaft abgebrochen. Nach dem Zivildienst im Sanatorium der Israelitischen Kultusgemeinde landete er im Jahr 2000 beim ORF- Jugendsender FM4 und arbeitete ab 2009 auch für Radio Ö1. Nach Tätigkeiten für „Wir sind Kaiser“ und „Dorfers Donnerstalk“ präsentiert er seit 2017 im ORF die „Pratersterne“, die seit dieser Staffel nicht mehr im Fluc am Praterstern aufgezeichnet werden, sondern in der Roten Bar im Volkstheater. Daneben tourt er mit seinem aktuellen Soloprogramm „Hosea“ durch Österreich.