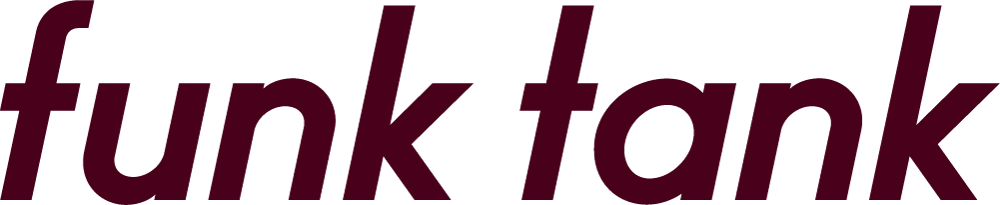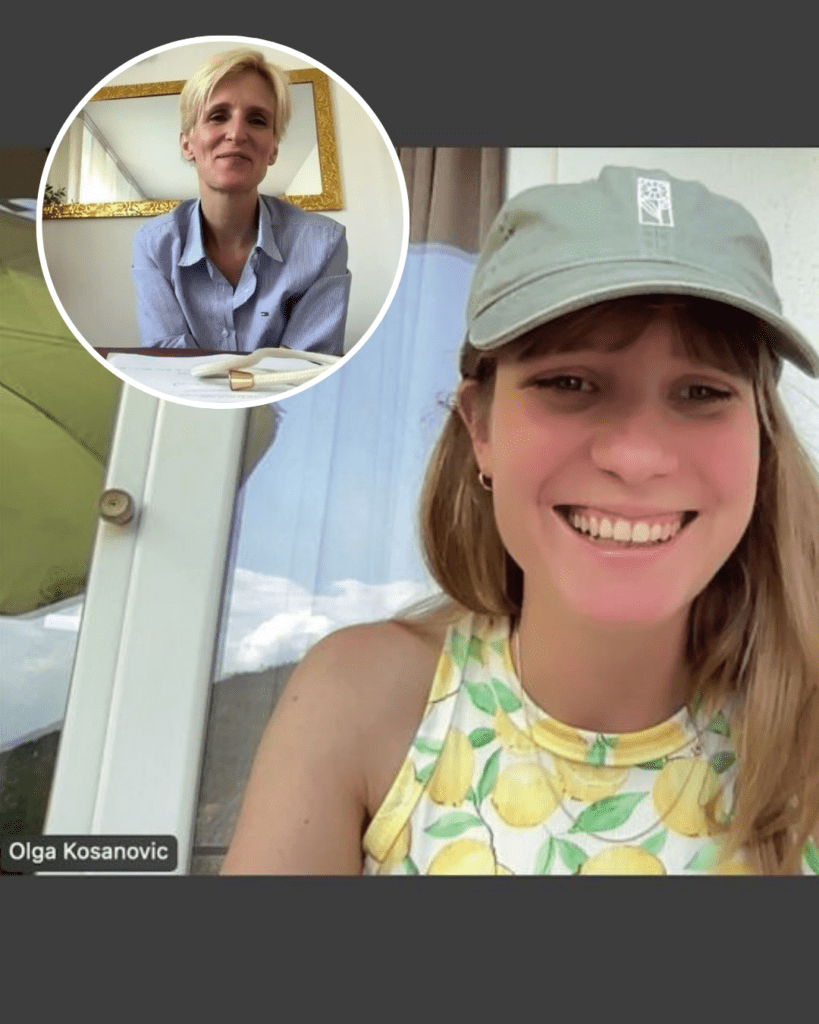Seit 1986 steht TEAM DR JOSEPH für Naturkosmetik mit Qualität, Wirksamkeit und Verantwortung. Gegründet von Erb. Dipl. Dr. Joseph Franz, ist die Marke heute ein internationales Familienunternehmen, das hochwertige Hautpflege mit Forschung und der Kraft der Natur vereint.
Lena Franz, Tochter des Gründers, leitet zentrale Bereiche des Familienunternehmens und repräsentiert gemeinsam mit ihren Brüdern Fabian und Viktor die nächste Generation. Im Interview erzählt sie, wie es ist, in einem Umfeld groß zu werden, in dem Familiengeist und unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen. Ein Gespräch über Transparenz, wirksame Inhaltsstoffe, individuelle Pflege und darüber, warum Nachhaltigkeit für die Unternehmer*innen kein Trend, sondern gelebte Haltung ist.
Lena Franz: Es ist herausfordernd, aber es hat definitiv mehr Vorteile als Nachteile. Klar gibt es Familien, die sich nicht verstehen. Bei uns ist es so, dass wir uns gut kennen und uns gegenseitig vertrauen. Dadurch können wir auch schneller Entscheidungen treffen.
Natürlich gibt es Reibungen, die gehören dazu. Manchmal ist eine Diskussion emotional aufgeladener, aber als Familie verzeiht man sich auch vieles schneller.
Wir ergänzen uns gut, weil wir aus total unterschiedlichen Bereichen kommen. Mein ältester Bruder Fabian hat ursprünglich Architektur studiert. Viktor hat Marketing und Wirtschaft gelernt und ich komme aus einem ganz anderen Bereich – ich habe Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert und einen Master in Philosophie. Wien war übrigens auch elf Jahre lang mein Lebensmittelpunkt.
Unser Vater ist das beste Beispiel für Vielfalt: Er ist klassischer Betriebswirt, aber gleichzeitig ausgebildeter Pflanzenheilkundler, er hat Erboristeria in Italien studiert. Das sind vermeintliche Gegensätze, die sich bei uns treffen. Ich finde das sehr fruchtbar, weil unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen ins Unternehmen eingebracht werden. Wenn alle das Gleiche studiert hätten und in die gleiche Richtung schauen würden, hätte man viele blinde Flecken. So wird alles aus unterschiedlichen Richtungen diskutiert und am Ende kommt meist eine Lösung heraus, von der wir alle überzeugt sind.
Er hat uns immer komplett freie Hand gelassen und das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Wir kennen viele Beispiele, wo der Senior bis 90 im Unternehmen sitzt und alles entscheidet. Da haben wir wirklich großes Glück.
Ihn hat immer mehr die Forschung interessiert – welche Pflanzen verwendet man wofür und diese Dinge. Er ist ein sehr großer Forscher. Wenn ihn ein Thema begeistert, findet man ihn hinter Büchern mit Stapeln an Informationen und Wissen.
Wir Kinder haben uns die Bereiche aufgeteilt, jede*r hat eigene Verantwortlichkeiten und das funktioniert gut. Die Übergabe war fließend und ungezwungen. Von der Seite unseres Vaters gab es nie den Druck, dass wir das Unternehmen weiterführen müssen. Es war ein freiwilliger Prozess.
Ich glaube, man verbringt einen Großteil seines Lebens bei der Arbeit. Und dort etwas Sinnvolles zu machen, etwas Eigenes, hinter dem man zu 100 % stehen kann – das ist für mich persönlich sehr wichtig. Unsere Philosophie ist uns in die Wiege gelegt worden.
Ja, das wurde uns gewissermaßen auch in die Wiege gelegt. Unser Vater hat das Unternehmen 1986 gegründet und damals war Naturkosmetik noch in den Kinderschuhen. Naturkosmetik wurde da eher belächelt.
Man merkt diesen Pioniergeist im Unternehmen bis heute. Da ist ein Gründer, der sehr lange gegen den Strom geschwommen ist und davon überzeugt war, dass das für ihn der richtige Weg ist. Für uns ist das daher die natürliche Richtung.
Wir haben das Glück sagen zu können, dass wir ein Unternehmen sind, das nicht auf einen Trend aufgesprungen ist, sondern seit Beginn aus tiefster Überzeugung so arbeitet. Das war viele Jahre nicht einfach, auch weil Rohstoffe extrem limitiert waren. Heute ist das Spektrum breiter, weil der Markt sich verändert hat.

Das neue Buzzword ist für mich nicht mehr Nachhaltigkeit, sondern Transparenz. Nachhaltig ist inzwischen irgendwie jede*r – der Begriff ist überstrapaziert und fast schon leer. Transparenz hingegen ist entscheidend. Genau daran haben wir in den letzten Jahren sehr intensiv gearbeitet.
Südtirol ist für uns der Ort, wo wir hineingeboren wurden und geblieben sind. Hier fühlen wir uns wohl, hier sind unsere Mitarbeiter*innen, hier ist unser Ursprung. Die Region steht für Handwerkskunst, Qualität und Präzision, das prägt uns.
Was wir aber nicht sind, ist alpine Kosmetik. Wir beziehen unsere Roh- und Wirkstoffe dort, wo die Pflanzen heimisch sind, weil sie dort ihre intensivste Kraft entwickeln. Die alpine Region bietet spannende Rohstoffe wie Edelweiß, aber diese sind limitiert. Deshalb arbeiten wir mit einem sehr breiten Wirkstoffspektrum.
Südtirol begeistert natürlich auch unsere Kundinnen und Kunden, wir sind primär in der DACH-Region präsent. Der ganze Spa- und Wellness-Bereich kommt aus der alpinen Region, daraus haben wir uns ja auch ursprünglich heraus entwickelt.
Zum Beispiel in Wien bei Staudigl, außerdem in 4- und 5-Sterne-Hotels, bei Kosmetikinstituten, ausgewählten Retail-Partnerinnen und Partnern und natürlich in unserem Online-Shop.
Nachhaltigkeit ist ein Bereich, in dem immer Luft nach oben ist. Wir arbeiten daran aber schon sehr lange, seit den 1980er-Jahren. Und auch wir haben da sicher nicht immer alles richtig gemacht. Packaging ist da ein großes Thema, das erst ein jüngeres Phänomen ist.
International positioniert uns die Vielzahl unserer Zertifizierungen. Die Kombination aus B Corp, PETA, COSMOS, Plastikneutral und Net-Zero ist in der Kosmetikbranche selten. Die B Corp-Zertifizierung ist eine Unternehmenszertifizierung und muss alle drei Jahre erneuert werden – mit verbessertem Punktestand. Da wären wir wieder bei der Luft nach oben.
Wir arbeiten mit Plastic Bank, wo Menschen in Entwicklungsländern Plastik sammeln und gegen Einkommen tauschen können. Außerdem mit dem Green Future Project, wo wir unsere CO₂-Emissionen tracken und kompensieren.
Unsere oberste Prämisse ist immer: zuerst reduzieren, dann kompensieren. Unsere eigene Produktion in Südtirol läuft zu 100 % mit erneuerbarer Energie.
Wenn ein Produkt nicht wirkt, hilft auch Nachhaltigkeit nichts. Hautpflege wird wegen ihrer Funktion gekauft. Wenn das passt, wird Nachhaltigkeit für viele zur Entscheidungshilfe.
Für uns war Nachhaltigkeit lange selbstverständlich, deshalb haben wir sie wenig kommuniziert. Heute sehen wir, dass Zertifizierungen auch Orientierung für Käufer*innen bieten.
Das neue Buzzword ist für mich nicht mehr Nachhaltigkeit, sondern Transparenz. Nachhaltig ist inzwischen irgendwie jede*r – der Begriff ist überstrapaziert und fast schon leer. Transparenz hingegen ist entscheidend. Genau daran haben wir in den letzten Jahren sehr intensiv gearbeitet. Gerade im Greenwashing-Dschungel stellt sich die Frage: Wie differenzieren wir uns wirklich? Nicht indem wir lauter behaupten, nachhaltig zu sein, sondern indem wir es belegen – mit Zertifizierungen, Daten und einer offenen, transparenten Datenlage. Wer wirklich interessiert ist, kann bei uns tief eintauchen und findet keine versteckten Leichen, sondern einfach noch mehr Informationen.
Unsere absoluten Bestseller sind die „Age Repair Miracle Drops“. Das Produkt, das unsere Geschichte am besten erzählt, ist aber wahrscheinlich das „Ultra Hydration Serum“. Feuchtigkeit braucht jede Haut. Man spürt die Textur, die Wirkstoffdichte und unsere 40-jährige Erfahrung.
Unsere Hauptzielgruppe liegt zwischen 35 und 60 plus, überwiegend weiblich, aber auch immer mehr Männer greifen zu unseren Produkten. Wir machen genderneutrale Kosmetik, weil es nicht die eine Haut gibt. Auch Männerhaut ist sensibel, Männerhaut ist auch reif, Männerhaut kann auch unrein sein. Da wir aus dem Institutsbereich kommen, haben wir ein extrem breites Sortiment an Produkten, das wirklich auf jedes einzelne Hautbedürfnis individuell eingehen kann.
Kinder brauchen per se keine Kosmetik, außer mineralischen Sonnenschutz. Der Trend zu Kinderkosmetik entspricht nicht unserer Philosophie. Da geht es mehr um Gewinnmaximierung.
Altern ist ein biologischer Prozess. „Anti“ suggeriert Kampf. Well-Aging bedeutet, schön und gesund älter zu werden. Unsere Produkte können unterstützen, aber keine Creme ersetzt Sport, Ernährung oder soziale Beziehungen.
Die perfekte Beauty-Routine gibt es für mich nicht. Es gibt immer nur die Routine, die für den einzelnen Menschen wirklich gut funktioniert. Sie hängt von vielen Faktoren ab: Hautzustand, Alter, Wohnort, Klima und Jahreszeit.
Ich selbst habe eine eher trockene, sensible Haut. Meine ideale Morgenroutine ist deshalb bewusst einfach: Ich reinige nur mit Wasser, verwende anschließend einen Toner, ein Serum und danach eine feuchtigkeitsspendende oder reichhaltige Creme. Eines meiner Lieblingsprodukte ist unsere „Couperose-Creme“, da ich leichte Couperose habe.
Und ein ganz zentraler Punkt ist Sonnenschutz. Das habe ich ehrlich gesagt auch erst in den letzten Jahren wirklich verinnerlicht. Konsequent jeden Tag SPF 50 zu tragen, macht einen enormen Unterschied für die Haut, bei jedem Wetter!
Ich glaube, ein zentrales Thema wird Hautgesundheit sein, eng verbunden mit Longevity, also der Frage, wie wir die Lebensqualität verlängern können, nicht nur die Lebensdauer. Dabei wird die belegte Wirksamkeit von Produkten immer wichtiger, denn Konsumentinnen und Konsumenten haben genug von großen Versprechen, die sich auf ihrer Haut nicht zeigen.
Ein weiterer Treiber ist die Individualisierung. Die eine Creme für alle gibt es nicht – Nutzer*innen wünschen sich Pflege, die wirklich auf ihre persönlichen Hautbedürfnisse eingeht, zum Beispiel auf trockene Wangen oder feine Linien im Augenbereich. Hier helfen modulare Produktlinien, gezielte Kombinationen und maßgeschneiderte Behandlungsmethoden. In unserer Schulungsakademie arbeiten wir mit Konstitutionstypen: Druck, Geschwindigkeit und Technik der Behandlung werden an den einzelnen Menschen angepasst – manche mögen intensive Berührungen, andere sanfte Streichungen.
Auch Technologie wird eine größere Rolle spielen, etwa durch künstliche Intelligenz in der Analyse. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach Menschlichkeit: echte Berührung und persönliche Zuwendung bleiben entscheidend.
Die spannende Herausforderung für die Zukunft liegt darin, Technologie, Nachhaltigkeit und Transparenz zu verbinden – in der Produktentwicklung, im Packaging und in der Behandlung.

TEAM DR JOSEPH ist ein familiengeführtes Naturkosmetik-Unternehmen aus Südtirol, das seit 1986 für hochwertige, wirksame Hautpflege steht. Die Marke verbindet Tradition, Forschung und Nachhaltigkeit und legt großen Wert auf Transparenz, Individualisierung und Hautgesundheit. Die Produkte von DR JOSEPH sind weltweit in ausgewählten Apotheken, Spas, Hotels und online erhältlich.