Emma ist enorm gefasst. Ihre Gesichtszüge entgleiten ihr genauso wenig, wie auch nur eine Haarsträhne aus ihrem festen Knoten. Doch ab und zu überkommt sie ein Würgereiz – beinahe lautlos und nur ganz kurz, es dauert kaum eine Sekunde. Wenn sie ihre Hand reflexartig zum Mund führt, um ihn zu verbergen, ist es schon wieder vorbei. Welche Worte, Gedanken, Impulse schluckt Emma – herausragend von Susanne Wuest verkörpert – da hinunter? Und welche Erinnerungen werden die kleine Alma begleiten, die auf dem Vierkanthof in der Altmark in den 1910er-Jahren aufwächst – und nicht nur ihre Mutter beobachtet, wie sie ihre Emotionen unterdrückt, wie sie schweigt?
In einer anderen Szene nageln die Töchter die Holzpantoffeln der Magd am Boden fest – und kichern herzhaft, als diese beim Hineinschlüpfen nach vorne kippt. „Ich erinnere mich, dass Mutti nie wusste, wann sie lachen soll“, sagt die Jugendliche Angelika (auch sehr genial: Lena Urzendowsky), die am selben Hof in den 1980er-Jahren mit ihrer Familie lebt. Was hatte sie erlebt? Oder: Was hatten ihre Mutter, Großmutter oder Urgroßmutter dort erlebt?
Mascha Schilinski und Louise Peter spürten für „In die Sonne schauen“ in jahrelanger, akribischer und feinfühliger Arbeit Frauenleben nach und schrieben ein Drehbuch, das durch vier Epochen führt. Nicht nacheinander, die Szenen greifen ineinander, sodass man nach dem Kinofilm manchmal gar nicht mehr genau weiß, welche Frau was erlebte. Das ist kein Zufall. Ebenso wenig, dass sich während man zusieht, völlig unerwartet eigene Lebensszenen dazu mengen – und das Bedürfnis, danach auch diesen Erinnerungen Raum zu geben. „In die Sonne schauen“ erhielt den Großen Jury-Preis in Cannes, er ist der deutsche Oscar-Vorschlag für die Kategorie Bester Internationaler Film – und Kritiker*innen schreiben Lobeshymnen.
Mascha Schilinski: Genau das, was du gerade gesagt hast. Wir haben versucht, Gefühle einzufangen, die ein Echo ergeben, damit die Menschen sich selbst erinnern und anfangen zu sprechen. Es ist ein riesiges Geschenk, dass wir erleben dürfen, wie sie sich berühren und – auch verdrängte – Bilder auftauchen lassen.
Selbst von Publikum mit 80 plus hören wir: „Ah, diese eine Geschichte hatte ich völlig vergessen …“ Da sage ich am liebsten: Schreibt sie alle auf, damit sie nicht verloren gehen.
Schön ist auch die Reaktion von vielen Männern, die teilweise sehr berührt auf uns zukommen und sagen: Sie verstehen sich ohnehin als Feministen, aber sie haben erst jetzt durch den Film kapiert, was es in bestimmten Momenten heißt, eine Frau zu sein.
Meine Co-Autorin Louise Peter und ich haben uns schon lange mit Sachen beschäftigt, die aus dem Benennbaren dieser Welt herauskippen. Mit feinstofflichen Fragen, für die man wie in einen Puls eines Menschen hineinkriecht, um seine leisen inneren Beben ausfindig zu machen, wo im Geheimen etwas zu Bruch ging. Das können auch kleine Dinge sein, aber vielleicht so schambehaftet, dass sie nie wieder erzählt werden. Was schreibt sich in unseren Körper? Was bleibt? Warum fühlen wir uns manchmal als Stellvertreter im eigenen Leben und wissen vielleicht nicht einmal für wen?
Es geht hier um transgenerationale Weitergabe von Traumata. Wir haben viele Phänomene und Geschichten zusammengetragen, beispielsweise Träume, von denen sich herausstellt, dass die Großmutter oder der Großvater die Geschichten eins zu eins erlebt haben. Wir haben uns dabei immer wieder gefragt: Wie sollen wir das in einen Film packen, wo es manchmal auch nur um ein Gefühl geht?
Dann kam Corona und wir sind aus Berlin auf diesen Hof geflüchtet, den ich schon zuvor kannte.

Plötzlich war der Gedanke da: Ihr wärt alle viel weniger alleine, wenn ihr voneinander wissen würdet. Wir alle.
Dort hat mich eine alte Kindheitsfrage erwischt: Wer saß schon einmal genau an dieser Stelle, wo ich gerade sitze? Was erlebte diese Person, was dachte sie – und was hat das mit mir zu tun? Wir verbrachten dort viel Zeit und fanden eine alte Fotografie von drei Frauen, drei Mägden. All das zusammen wurde zum Startschuss, diesen Hof als eine Art Gefäß zu nehmen, um sichtbar zu machen, was durch die Zeit kommt. Wir wollten nie eine Hauptfigur, die wie eine Detektivin durch die eigene Geschichte geht, uns ging es um die Momente, in denen man sich fast von seinem Körper verraten fühlt, in denen man sich fragt: Woher kommt das denn jetzt?
Wir hatten zunächst auch männliche Figuren und gar nicht die Intention, den Film aus einer fast rein weiblichen Perspektive zu erzählen. Wir haben zwei Jahre lang eine Materialschlacht gemacht, aus unserem inneren Material, aus Interviews, die wir in der Region geführt haben, wir haben die Stadtbibliothek in Stendal geplündert und unter anderem minutiös erzählte Beschreibungen von Männern entdeckt, wie ein Hof geführt wurde. Dann fanden wir zwei Bücher von Frauen, die in einem Bullerbü-artigen Ton von ihrer Kindheit und dem verlorenen Paradies erzählten, die eine Landidylle beschrieben. Mittendrin, im gleichen Ton und fast aus einer kindlichen Perspektive, fanden wir dann Halbsätze, die total verstörend sind. Da stand dann etwa: Die Magd müsse erst „gemacht“ werden, damit sie für den Mann ungefährlich ist.
Wir haben dann die Recherchen über Mägde ausgeweitet, auch auf Österreich und die Schweiz. Was wir da fanden, war so finster, dass es finsterer gar nicht geht. Egal wo die Mägde lebten, sie galten nicht als Personen, sondern als eine Sache. Sie hatten kein Leben, im Gegensatz zu den Knechten hatten sie nicht einmal einen freien Abend, und sie lebten immer im Bangen darum, dass sie ausfallen könnten, wenn sie krank oder schwanger werden, und dann vom Hof verscheucht werden.
Wir konnten im Einzelnen gar nicht die ganze Bedeutung dieser „Halbsätze“ herausfinden, und nahmen sie auch genau aus dem Grund hinein: weil da offenbar Wissen verloren gegangen ist, weil etwas so schambehaftet war, dass es nicht weiter erzählt wurde. Wir ließen dann mit Hilfe der Figuren fast halluzinativ Bilder aufsteigen und verknüpften sie miteinander.
Es geht uns auch darum, wie Erinnerung und Vorstellung ineinander greifen. Die Bilder, die wir nicht sehen, sind eigentlich noch wichtiger: Wo wurde etwas abgespalten, worauf haben wir keinen Zugriff mehr, wo musste etwas ertränkt werden, damit man weiterleben kann.

Ja. Irgendwann wurde uns klar: Der Unterschied besteht darin, dass Frauen bestimmten Blicken unterzogen sind, die Männer einfach nicht kennen. Punkt (sic!). – Welche Blicke sind das? Und wie blicken die Frauen zurück? Diese Blicke einmal in hundert Jahren Leben der Frau anzuschauen holen wir jetzt ins Zentrum.
Diese Dinge passieren bis heute. Wir werden uns in unserer westlichen Bubble zumindest bewusster darüber.
Einerseits. Und andererseits haben wir festgestellt, dass sich bestimmte Sachen weiterhin loopen. Viele, die wir befragt haben, wo es in der Familie Traumata gab, wollen sich lieber von ihren Vorfahren entkoppeln, sie wollen nichts damit zu tun haben, sich lieber abgrenzen und alles anders machen, das kennen wir natürlich auch.
Es ist aber ganz oft nicht der Vorfall allein, der etwas kaputt macht, sondern der Umgang danach, das Isoliertsein mit dem Trauma. Den Zugriff darauf verliert man, weil es tabuisiert ist.
Umso schöner war es im Film, als wir gemerkt haben, dass diese Frauen über die Epochen wie in einem Kreis zusammenstehen, sie geben sich gegenseitig Schutz. Plötzlich war der Gedanke da: Ihr wärt alle viel weniger alleine, wenn ihr voneinander wissen würdet. Wir alle.
Die deutsche Filmemacherin Mascha Schilinski wurde 1984 in Berlin geboren. Ihre berufliche Laufbahn startete sie bei einer Kinder- und Jugend-Castingagentur für Film, ehe sie für Jahre auf Reisen ging und zu schreiben begann. Sie absolvierte die Drehbuch-Masterclass an der Filmschule Hamburg und machte später das Regiestudium an der Filmakademie Baden-Württemberg. Ihr preisgekrönter Kurzfilm „Die Katze“ entstand bereits im zweiten Studienjahr, ihr erster Spielfilm „Die Tochter“ wurde ebenfalls vielfach ausgezeichnet und lief auf internationalen Festivals.
Bei „In die Sonne schauen“ führte Mascha Schilinski Regie, das Drehbuch schrieb sie gemeinsam mit Louise Peter. Kinostart in Österreich war am 7. November 2025. Großartig in den Hauptrollen sind u. a. Lena Urzendowsky, Luise Heyer, Laeni Geiseler und Susanne Wuest.
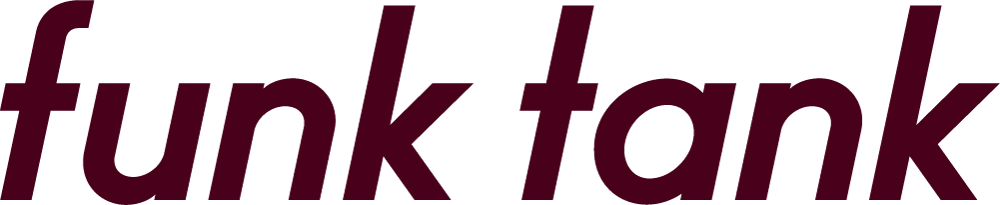











Noch kein Kommentar, Füge deine Stimme unten hinzu!