Am weitläufigen Grenzareal von Nickelsdorf stehen vorwiegend flache Gebäude und Containerbüros. Der Sturm hat an diesem sonnigen Februartag quasi freie Fahrt, um Bäuche in die Wände der offenen, scheinbar gerade leeren Versorgungszelte zu blasen. Während ich im Auto auf Judith Kohlenberger, mehrfach preisgekrönte Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik der WU Wien warte, tauchen vor dem geistigen Auge Bilder aus den vergangenen Jahren auf. 2015 wurden hier täglich Tausende von Menschen versorgt, die vorwiegend vor dem Krieg in Syrien flüchteten. Ab dem Februar 2022 waren es zum Großteil Flüchtende vor dem Krieg in der Ukraine.
Mit Büchern wie Das Fluchtparadox (Kremayr & Scheriau) oder So schaffen wir das (mit Othmar Karas, edition a) entfacht Judith Kohlenberger Diskussionen, ebenso wie mit ihrem Podcast Aufnahmebereit. Ihre Analysen und Fragen stoßen laufend viele neue Türen auf. Aktuell steckt sie erneut knietief in der Forschung einer Perspektive, die uns alle betrifft. Im Sommer erscheinen zwei neue Bücher darüber.
„Entschuldigung, es hat doch etwas länger gedauert“, sagt sie, als sie die Autotür öffnet. Mich stört es nicht, ich hatte genügend Lesestoff mitgenommen, und der Grund für den Hauch einer Verspätung ist ein gutes Zeichen dafür, dass es zuvor gute Gespräche waren. Um mich in Judith Kohlenbergers üppig bestückten Kalender zu quetschen, führen wir das Interview während einer Autofahrt zum nächsten Termin. Zudem erschien es uns passend, das Gespräch an der Grenze von Nickelsdorf zu starten. Die Eindrücke von den vorangehenden Unterhaltungen sind noch frisch.
Wir verlassen sozusagen das Grenzareal. Um erneut nach Österreich zu gelangen, muss ich mich von einer Seitenstraße in die wartende Autoschlange einreihen. Wer nicht genau schaut, hält mich für eine ungeduldige Dränglerin. Ich winke entschuldigend und lächle beschwichtigend dem nächsten Autofahrer zu, werde prompt mit einem wütenden Blick bestraft, und er drückt aufs Gas. Wie passend zu den Themen, die wir danach besprechen werden.
Judith Kohlenberger: Der Arbeitstitel lautet „Gewalt und Grenzen“. Es geht darum, wie das, was an unseren Grenzen passiert, die Gesellschaft nicht unberührt lässt. Auf vielfache Art.
Ich führe Interviews mit unterschiedlichen Ebenen der Aufnahmegesellschaft, inwiefern die Grenze oder die indirekte Erfahrung von Gewalt, die an der Grenze passiert, also die Zeugenschaft davon, sie verändert. Ich habe mit Flüchtlingshelfer*innen in Österreich, Deutschland, auf Lesbos und entlang der Balkanroute geredet und mit Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen und Supervisor*innen, die vor allem Flüchtlingshelfer*innen betreuen. Ich habe auch Grundwehrdiener, die in Kittsee oder Andau im Einsatz waren, getroffen – viele junge Burschen, die von ihrem Einsatz eine ganz andere Vorstellung hatten. Die nehmen auch etwas mit davon.
Wie mit Geflüchteten verfahren wird, hat eine Signalwirkung.
Mit den Grenzpolizist*innen in Nickelsdorf. Eine gute Basis für meine Arbeit hier ist, dass ich aus dieser Region komme. Ich bin in Wallern aufgewachsen, in der Nähe der Brücke von Andau, ein historisch wichtiger Ort. Ich wurde 1986, zur Zeit des Kalten Krieges, geboren, kannte noch den Eisernen Vorhang und kann mich an stundenlange Wartezeiten und Grenzstaus erinnern. Mit dem Beitritt Ungarns zum Schengener Abkommen und später zur EU war die Grenze nicht mehr spürbar. 2015 hat sie sich wieder stärker bemerkbar gemacht. Ich wollte schauen: Was bedeutet das hier für die tägliche Arbeit der Polizei?
Was ich aus allen Gesprächen mitgenommen habe: Die Sinnhaftigkeit der Aufgaben, dass beispielsweise gewissenhaft kontrolliert wird, ist für alle klar. Kommt es zu vielen Aufgriffen, wird die Arbeit dennoch als sehr belastend, als ein nie versiegender Strom erlebt. Hat man – zu Spitzenzeiten – etwa 100 Asylwerber*innen abgearbeitet, kommt der 101.
Den Grenzpolizist*innen ist sehr bewusst: Solange die Ursachen nicht angegangen werden, kann man noch so viele Zäune bauen, die Leute werden trotzdem kommen. Das hat mich beeindruckt, denn das belegt auch die Migrationsforschung. Ob das nun Trump ist mit build the wall oder ob es sich um Pläne in Europa handelt – nur die Politik tut so, als könnten Zäune Probleme lösen, die Menschen kämen dann über andere Wege.
Sehr differenziert. „Es gibt solche und solche“, sagen sie. Es kommen verarmte Menschen mit den letzten Mitteln, die sie haben, und Menschen, die vermögend sind. Manche seien kooperativ, manche präpotent. Sie begegnen – wenig überraschend – der gesamten Bandbreite der Menschheit. Betont wurde stets die Wichtigkeit der Kontrolle. Das ist auch ein großes Bedürfnis der Bevölkerung: Wenn Zuwanderung, dann in geordneter Form. Aber: Wir haben zu viele irreguläre und kaum reguläre Wege für Zuwanderung. Meine Interviews zeigten klar: Die Erkenntnisse aus der Migrationsforschung decken sich mit jenen aus der Praxis.
Es geht darum zu schauen, wie Gewalt an der Grenze – physische oder bürokratische –, die den Schutz suchenden Migrant*innen angetan wird, peu à peu auch eine Gesellschaft im Inneren verändert. Wir verstehen Fluchtforschung als Demokratieforschung, weil Flucht nach Europa die Grundfesten von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie betrifft. Meine These ist, dass die Bevölkerung in Ländern wie Ungarn oder Griechenland sukzessive daran gewöhnt wird, dass Rechtsbrüche nicht geahndet werden und dass Asylrecht laufend gebrochen wird – ohne juristische Folgen. Es gibt Videobeweise für Pushbacks der griechischen Küstenwache – ohne Konsequenzen. Das untergräbt die Grundfesten von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Wie mit Geflüchteten verfahren wird, hat eine Signalwirkung. Sie haben die Funktion eines Brandmelders: Obacht, da passiert etwas, das sich weiter fortsetzt, das weiter in die Gesellschaft hineinwirkt. Geflüchtete sind sozusagen der „weakest link“, das schwächste Glied, woran sich negative Entwicklungen als erstes zeigen.

Wir beobachten eine immer stärker werdende Unverzeihlichkeit und Unversöhnlichkeit in der politischen Debatte. Man unterstellt dem Gegenüber zuerst einmal das Schlechtestmögliche anstatt des Bestmöglichen.
Einerseits geht das Vertrauen in den Rechtsstaat Stück für Stück verloren, andererseits passiert eine Verrohung der Gesellschaft. Ein Gerichtsmediziner in Griechenland hat mir berichtet, dass es beim Grenzfluss Evros nahezu normal ist, dass dort menschliche Überreste ans Flussufer gespült werden, wo auch Kinder spielen. Oder: Man sitzt in einer lauen Sommernacht auf Lesbos auf der Terrasse und hört die Schreie von zurückgepushten Migrant*innen. Das macht natürlich etwas mit einer Grenzregion – die Bewohner*innen werden damit weitgehend alleine gelassen. Lesbos hat vorwiegend von Tourismus gelebt, das wird zunehmend schwieriger.
Das Problem ist: Es wird eine Seite gegen die andere ausgespielt. Der Frust der griechischen Bevölkerung wird auf die Flüchtlinge gelenkt. Das ist am einfachsten, darauf ist das System ausgelegt. Aber natürlich hätten die Flüchtlinge lieber andere Wege, als mit dem Schlauchboot zu kommen.

Es brechen die Dämme, da ist eine neue gesellschaftliche Härte. Schon in den letzten Jahren, vor allem seit 2015, hat sich innerhalb der europäischen Gesellschaft etwas verhärtet, und dann kam auch noch die Pandemie. Wir beobachten eine immer stärker werdende Unverzeihlichkeit und Unversöhnlichkeit in der politischen Debatte. Man unterstellt dem Gegenüber zuerst einmal das Schlechtestmögliche anstatt des Bestmöglichen.
Das Schwierigste ist, wenn man miteinander nicht mehr in irgendeine Form des Austauschs tritt. Da verhärtet sich etwas, absurderweise sogar innerhalb von linken Bewegungen. Die Verrohung passiert auch in Institutionen. AMS-Berater*innen und Mitarbeiter*innen von Behörden müssen immer mehr Deeskalationstrainings machen, weil das Aggressionspotenzial der Bevölkerung steigt. Es gibt Angriffe auf Rettungskräfte – nämlich von Patient*innen, die ein solch hohes Anspruchsdenken haben, dass sie „zuerst“ gerettet werden wollen. Selbst auf Obdachlose wird eingestochen … Das sind alles Symptome, und ich glaube, dass es einen Konnex dazu gibt, was an der Grenze passiert. Die Journalistin Franziska Grillmeier spricht von einem „Gürtel der Gewalt“. Es gibt seit 2015 zigtausende Grenztote, die den Kontinent säumen, natürlich hat das Auswirkungen auf das Innere der Gesellschaft.
Es macht auch einen Unterschied, wie man über diese Menschen redet. Vielfach wird eine dämonisierende Sprache verwendet, was nicht folgenlos bleibt. Wann übersetzt sich die gewaltvolle Sprache in eine gewaltvolle Tat? Das ist ein Einfallstor.
Die Zugewandtheit der Abhärtung und der Abschottung vorziehen. Es geht darum, sich immer die Menschlichkeit des Anderen zu vergegenwärtigen. Das ist das Problem an den sozialen Medien: Wenn du den anderen nicht mehr siehst, eskalieren die Dinge schneller.
Ich fand es sehr schön, was die Grenzpolizist*innen gesagt haben, nämlich: „Was uns alle trägt, ist, dass wir zusammen gehören. Wir sind eine Gemeinschaft.“
Was wir jedenfalls positiv sehen können: Die österreichischen Grenzpolizist*innen kennen das Fremdenrecht, und ich würde behaupten, außer in Ausnahmefällen passieren hierzulande keine Pushbacks. Nach der langen Reise, die oft Flüchtlinge hinter sich haben, ist Österreich das erste Land, in dem der Rechtsstaat zur Durchsetzung gebracht wird. In puncto Rechtsstaatlichkeit, auch und gerade im Asylbereich, könnten wir selbstbewusst als Vorbild auftreten.

Judith Kohlenberger ist Kulturwissenschafterin und Migrationsforscherin mit den Forschungsschwerpunkten Fluchtmigration und Humankapital (vor allem Bildung und Gesundheit), Integration und Zugehörigkeit, Frauen und Flucht sowie kulturelle Krisennarrative. Die mehrfach preisgekrönte Forscherin hat zahlreiche Sachbücher veröffentlicht und hostet den Podcast „Aufnahmebereit“, ein Wissenschaftsvermittlungsprojekt, das sich Ankommenden und Aufnehmenden in der modernen Migrationsgesellschaft widmet.
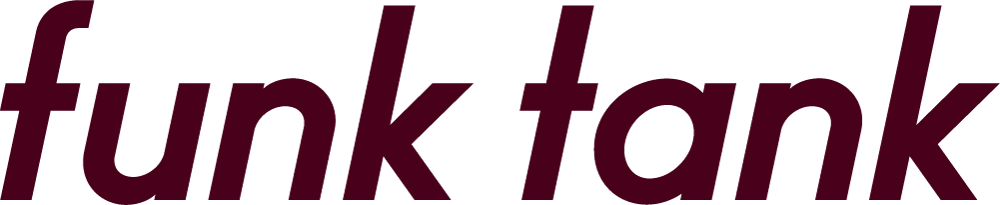











Noch kein Kommentar, Füge deine Stimme unten hinzu!