Verschwommenen Erinnerungen nach befand ich mich im Vorschulalter, als meine Eltern mich erstmals in unser steirisches Provinzkino mitgenommen haben. Es lief ein Schneewittchen-Film, einer mit echten Menschen in artifiziellen Landschaften.

Eine ganz große Märchenleidenschaft erfasste mich schon in jüngsten Jahren, vor allem für die Erzählungen der Grimmigen Brüder. Aber weder die Inszenierungen meines Vaters, der manche Charaktere gruselig nachspielte, noch die krächzenden Hörspielplatten mit ihren unheilvollen Sprecher*innen-Stimmen, wappneten mich für das bedrohliche Geschehen auf der Leinwand. Ich habe vermutlich nur Teile dieses Films, der wohl aus den ostdeutschen DEFA-Studios stammte, hinter vorgehaltenen Fingern gesehen. Vielleicht wimmerte ich auch im Kinosessel, von meinen Eltern an den Händen gehalten, als die böse Stiefmutter in Großaufnahme grinste.
Wenn sich das nach Trauma anhört, folgt jetzt gleich eine Entwarnung. Meine Eltern machten mir sehr früh klar, dass Filme nicht echt sind. Die Wirklichkeit, das waren der verhasste Kindergarten, später die prügelnde Volksschullehrerin, die unlösbaren Rechenaufgaben und die mobbenden Mitschüler. Im ländlichen Kinosaal, wo es damals, wir sprechen übrigens von den frühen 70er Jahren, immer leicht muffig gerochen hat, konnte mir nichts und niemand etwas anhaben.
Außer vielleicht der Kinderfänger in „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“, dem ich an einem weiteren legendären Filmnachmittag mit den Eltern begegnete. Über neunzig Minuten lang lullt dieses aufwändige Musical das kleine (und große) Publikum mit Singen, Tanzen und knallbuntem Spaß ein. Dann führt die Story die Protagonist*innen, eine britische Patchwork-Family, in ein Fantasiereich, das wie ein deutsch-österreichisches Disneyland wirkt. Als dort, in den verwinkelten Gassen eines malerischen Fachwerkbauten-Städtchens, plötzlich der Kinderfänger auftaucht, verdunkelt sich die Stimmung in dem Film abrupt.
Der Schock dieses unvermittelten Einbruchs des Grauens in die zuckersüße Idylle paralysierte wohl nicht nur mich. Die Furcht, von der dürren Gestalt im schwarzen Kostüm ebenfalls in den klapprigen Pferdewagen gepackt zu werden, verfolgte mehrere Kindergenerationen. Mir bescherte der Auftritt des Kinderfängers aber zugleich eine ewige Lust an Horrorfilmen. Denn letztlich siegte das Sicherheitsgefühl.
Eine Karriere als Movie-Junkie
Mein erster Kinobesuch, bei dem ich als tapferer Volksschüler dann alleine auf die Leinwand starrte, nachdem mich die Begleitpersonen abgeliefert hatten, nannte sich „King Kong: Frankensteins Sohn“. Es folgte „Frankenstein: Der Schrecken mit dem Affengesicht“. Und „Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn“. Frankenstein tauchte sehr oft im deutschen Verleihtitel japanischer Billigmonster-Spektakel auf, in den Filmen selbst aber nie. Ich sah (mehrfach) den Untergang Tokyos, (Spielzeug-)Panzer im Kampfeinsatz, riesige Urzeit-Kreaturen, die die moderne Zivilisation zerstampften.

Meinen uneingeweihten Mitschülern (es waren tatsächlich nur Buben damals) erzählte ich am nächsten Tag wilde Storys über Riesenaffen, so groß, dass sie ganz New York in ihrer Pratze hielten. Die Fantasie überschlug sich. Die Freude war riesig. Keine der sonntäglichen Nachmittagsmatineen in den lokalen Ton-Licht-Spielen entging mir mehr.
Und so begann eine Karriere als Movie-Junkie und cinephiler Gänsehaut-Liebhaber. Denn als reales Angsthäschen, gebeutelt vom Turnunterricht-Terror und gestresst von Mathematik-Hausaufgaben, wurde ich bald süchtig nach der Überwältigungskraft des Mediums Film. Gegen die apokalyptische Zerstörung durch Godzilla & Co. schrumpfte der Schrecken, wieder einmal unter den strengen Augen der Lehrerin-Domina nachsitzen zu müssen. Und nicht nur das: Die Kinobesuche erweiterten ungemein den engen Kleinstadt-Blickwinkel, in Technicolor und Cinemascope, plötzlich gab es eine Welt der fremden Kulturen, der wilden Abenteuer und echte Gefahren.
Ich fühlte mich in Japan, mit seinen verrückten Wissenschaftler*innen und Riesenmonstern, heimischer als in Österreich. Ich ritt mit einem französischen Native American namens Winnetou durch kroatische Western-Landschaften. Ich freute mich auf Besuche im nebligen Kulissen-London von Edgar Wallace, aufgebaut in Berliner Hinterhof-Studios. Die Genrefilme, in denen stets das Gute siegte, standen auch für einen moralischen Kompass, der einen durch die verwirrenden Sittenansichten der Dekade navigierte. Ergänzt durch Comic-Superheld*innen, die humanistischen TV-Weisheiten eines Captain Kirk oder den anarchischen Gestus der Prä-Punkrockerin Pippi Langstrumpf, lernte ich auch etwas fürs Leben.
Die Genrefilme, in denen stets das Gute siegte, standen auch für einen moralischen Kompass, der einen durch die verwirrenden Sittenansichten der Dekade navigierte.
Rein in die Jugendverbot-Vorstellung
Nicht immer wurde dabei der kindliche Adrenalinpegel in die Höhe gejagt. Verblödelte Paukerfilme, Naturdokumentation aus dem Hause Disney und tschechische Animationsklassiker lösten sich ab. Wichtig für den zukünftigen Autor dieser Zeilen war aber nur das Drama. Als mein spiritueller Blutsbruder Winnetou für mich unerwartet erschossen wurde, brach die Welt zusammen. Zwei Wochen später saß der Apachenhäuptling aber schon wieder auf seinem treuen Pferd Iltschi. Kino kann das, lernte ich. Es lässt die Helden wieder aufstehen, macht dir Angst und nimmt dir Ängste.
Eine Anekdote muss ich noch loswerden. Ich war zirka zehn Jahre alt, als mich mein Vater auf dringliches Bitten hin in eine Jugendverbot-Vorstellung von „Todesgrüße aus Shanghai“ schmuggelte. Der Ruf der verstorbenen Kung-Fu-Ikone Bruce Lee war zuvor bis in die steirische Provinz gedrungen. Die fast schon übermenschliche Kampfkunst, die ekstatische Verausgabung. All das ließ mein Herz rasend schnell klopfen. Nach diesem Kinobesuch war der Alltag vollends verändert: Voller übergroßer Gefühle und fliegender Körper, exotisch, kosmopolitisch, vibrierend.
Meinem Vater hat es nicht gefallen. Ich durfte danach aber mit anderen erwachsenen Begleitpersonen in das verbotene Reich eindringen. Italowestern, Science-Fiction-Epen, Biker-Movies, Zombie-Reißer, dazwischen Superman, Darth Vader und noch viel mehr Kung-Fu. Als bester Kunde der lokalen Tonlichtspiele gehörte ich bald zum Repertoire.
Das Flackern des Projektors
Tausende Filme folgten, in größeren Städten und bombastischeren Sälen. Im verschneiten Berlin hab ich als Teenager mal Weihnachten in einem Programmkino verbracht, mit dem „Texas Chainsaw Massacre“ und den „Gremlins“ natürlich. Inmitten kiffender Punks entdeckte ich meine Liebe zu Joe Dantes Kobolden und zur Hauptdarstellerin Phoebe Cates. Ich besitze heute Gizmo-Handpuppen und Gremlins-Spielzeug. Ich weine verlässlich, wenn der kleine, süße Mogwai singt, nach dem sich auch eine Band benannt hat. Viele Jahrzehnte später durfte ich Joe Dante treffen, den Gremlins-Schöpfer. Ein Kreis hat sich geschlossen.
Mir fallen etwas verstörende Kinobesuche mit meinem Vater ein, abseits vom Kung-Fu-Kino. „Die Blechtrommeln“, „Trio Infernal“, „The Man Who Fell to Earth”, die Stories verstand ich nicht immer, aber unvergessliche Bilder umso mehr. „Apocalypse Now“, den ich als Teenager mit meinem älteren Bruder zusammen sah, ließ mich wochenlang nicht los.
Ambitionierte Arthouse-Werke lösten in meiner Jugend zwischendurch den schönen Schund der jungen Jahre ab. Grenzen zwischen Kunst und Kommerz, Kompromisslosigkeit und Kitsch gab es aber nie in meiner filmischen Wahrnehmung. Unschuldiger Feel-Good-Eskapismus ist zwischendurch herrlich, aber Abgründe bleiben höchst anziehend, vor allem auch wenn sie romantischer Natur sind.
Denn das ist die vielleicht essentiellste Prägung, die meine ersten kindlichen Kinoerfahrungen hinterlassen haben: Verstörung und Betörung liegen oft ganz nah beieinander. Letztlich spendet das Flackern des Projektors, das Flimmern auf der Leinwand, das Glühen im Dunklen, Trost, und gibt Hoffnung.
Ein guter Film, gerade wenn er dich ernsthaft aufwühlt, steht für pures Glück.
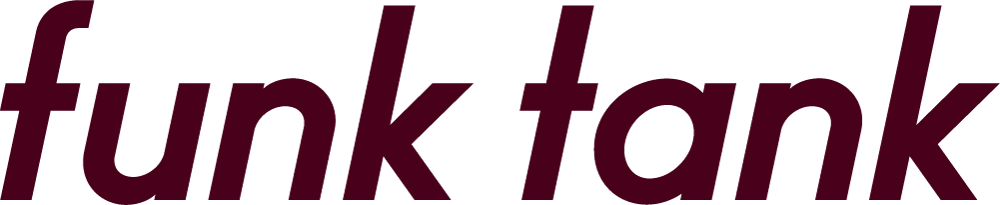











Noch kein Kommentar, Füge deine Stimme unten hinzu!