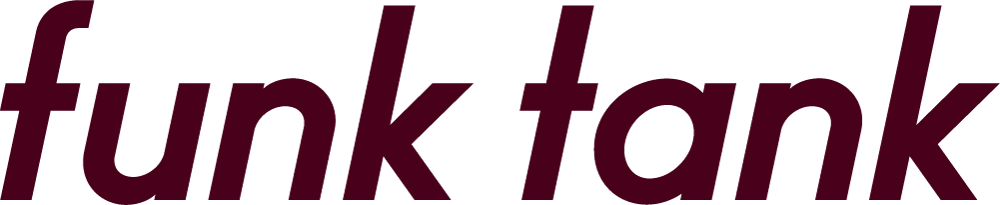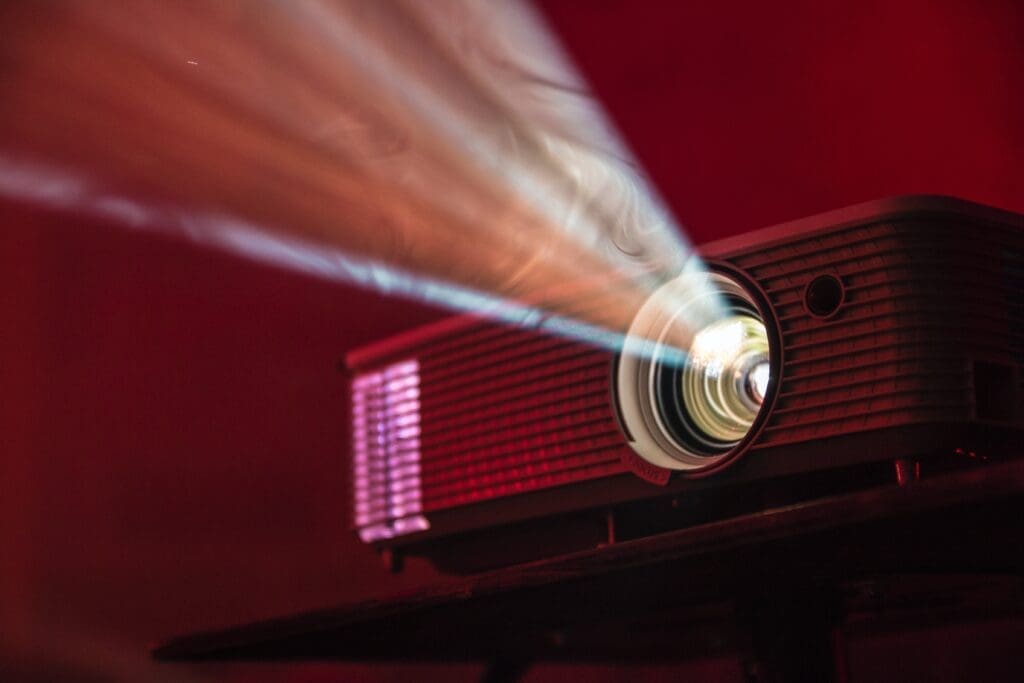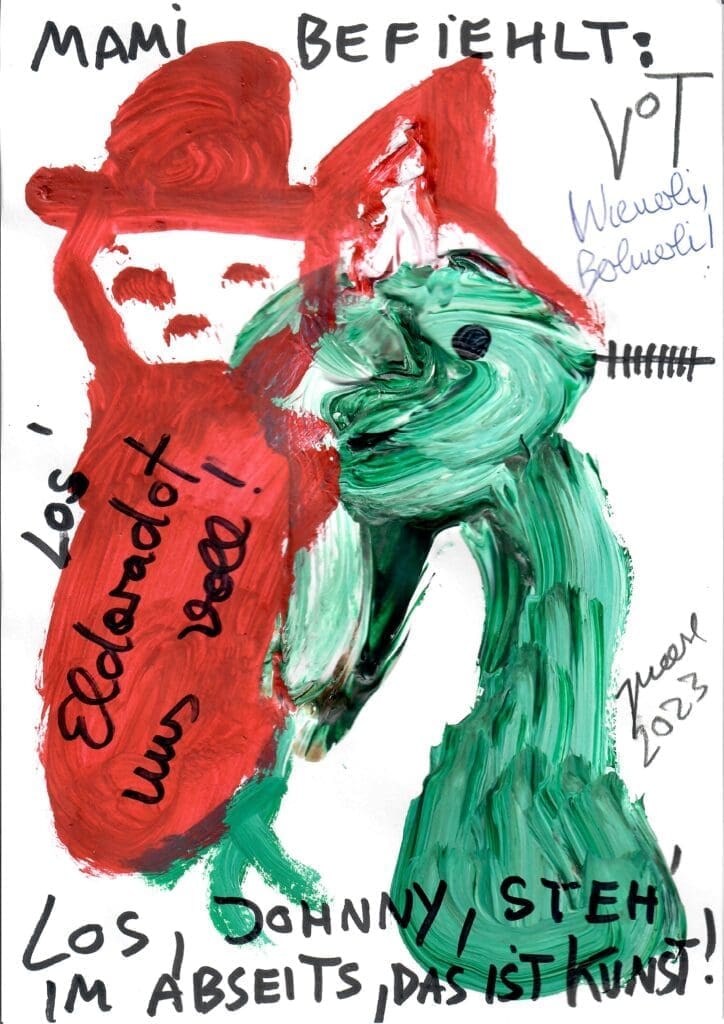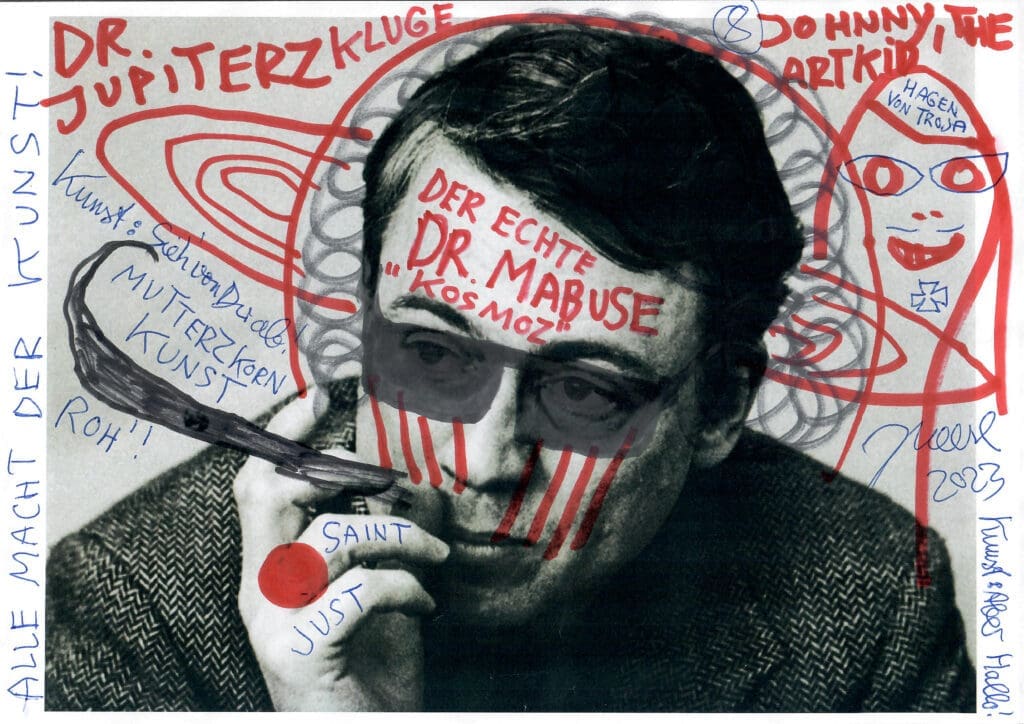Snub. Eines der häufigsten Wörter der letzten Jahre in der Medienbranche. „An act of rebuffing or ignoring someone or something“, weiß das Oxford Dictionary, also die Zurückweisung oder das Ignorieren von etwas oder jemandem. Eine gar nicht so feine reziproke Spielart des ständigen Offended-Seins, das in praktisch allen Bereichen des Lebens um sich greift. Da, wo passende Gefühle als Moralkompass einfacher zu handhaben sind als unangenehme Fakten. Wenn einem also eine Jury-Entscheidung nicht recht ist, wird eben jener Jury ein bösartiger Snub unterstellt. Zum wohl aktuellsten Beispiel zählen die Nicht-Oscar-Nominierungen von Margot Robbie als Leading Actress und Drehbuchautorin und Regisseurin Greta Gerwig als Best Director, beide für den Film Barbie, was die aufgeregte, systematische Misogynie witternde Interneteria dabei noch mehr zur Rage treibt. Ausgerechnet für die Rolle des Ken, der im Film toxisches Patriarchat etablieren will, wurde Ryan Gosling als Best Supporting Actor nominiert – ganz klar aus Sicht der Couchposter, TikToker und sonstigen Filmexperten. Die alten, weißen Männer haben es sich in Hollywood wieder mal gerichtet und vergönnen Frauen rein gar nichts. Was für ein Unfug!
Zahlen lügen nicht – oder doch?
Das oft angeführte Argument, acht Oscar-Nominierungen für den finanziell erfolgreichsten Film des Jahres stehen in keinem Verhältnis zu dem für 13 Nominierungen dritteinträglichsten Film des Jahres Oppenheimer ist völliger Quatsch. Wenn dem so wäre, müsste sich der zweiterfolgreichste Film des Jahres ja bei gefühlten zehn Listenplätzen einpendeln. Jedoch: The Super Mario Bros. Movie ist für gar keinen Oscar nominiert. Man sieht also schon, wie schnell solche Debatten peinlich werden können, wenn man Wunsch und Wirklichkeit vermengt. Die übrigens an Nominierungen fast gleichauf liegenden Filme Killers of the Flower Moon (10) und Poor Things (11) lassen die Diskrepanz zwischen Award-Tauglichkeit und Einspielergebnis noch weiter aufklaffen. Mit Platz 46 respektive 83 im weltweiten Boxoffice-Ranking liegen die beiden nämlich weit hinter – bei Filmpreisen chancenlosen – Cringe-Festivals wie Fast X (Platz 5) oder Meg 2: The Trench (Platz 19).
Sinnerfassendes Lesen
Abgesehen von den schnöden Zahlen sorgen aber vor allem die in der allgemeinen Empörung gerne unter den Teppich gekehrten positiven Faktoren für eine verzerrte Wahrnehmung. Fakt: „Barbie“ ist als einer von zehn Filmen unter hunderten in die letzte Auswahl als „Best Picture“ gekommen, quasi der Grand Prix des Abends. Per Definition also der Film, der der Academy subjektiv am besten gefallen hat. Dieser Preis wird an die Produzent*innen verliehen. Und siehe da: In diesem Quartett finden sich nicht nur zwei männliche Filmschaffende, sondern auch Robbie Brenner, die weibliche Präsidentin von Mattel Films sowie die angeblich so – jetzt kommt’s – gesnubbte Margot Robbie. Auch die teilweise beklagte Nominierung von Greta Gerwig in der gegenüber bestes Originaldrehbuch vermeintlich geringeren Kategorie bestes adaptiertes Drehbuch ist unnötige (und sachlich falsche) Kritik, denn es handelt sich um eine Form des Drehbuchs, bei dem das Skript auf einer zuvor veröffentlichten Publikation beruht. Nun, Barbie-Puppen und ihr zugehöriger Lore sind seit 1959 etabliert, vom Originalstoff sind wir da trotz der durchwegs genialen Interpretation weit entfernt.
Es kann nur eine(n) geben
Bleiben also nur noch die höchst strittigen Kategorien, wo es um große Emotionen, schwer quantifizierbare Handwerkskunst, Publikumsreaktionen und vor allem um eine unschätzbare Steigerung des Marktwertes von Personen in Tinseltown geht. Oscars für bestes Schauspiel oder die beste Regie. Und hier gilt, mehr als in allen anderen Disziplinen, das alte Sprichwort: „Das Glück is a Vogerl.“ Jedem ist die Jahre und fünf Nominierungen dauernde Durststrecke von Leo DiCaprio bis zum begehrten Gewinn des Goldmännchens als bester Mime ein Begriff. Pipifax freilich gegen den großen Peter O’Toole oder auch Glenn Close, die mit je acht Nominierungen und null Siegen ein ganz anderes Lied sangen. Kein Grund zum Jammern also für die erst 33-jährige Margot Robbie. Sie konnte bisher dank ihres Talents sowieso schon zwei Nominierungen einheimsen, allerdings für weit forderndere Rollen. Denn sind wir uns ehrlich: Mit ihrem von Natur aus bezaubernden Aussehen musste sie weit weniger Aufwand in die Rolle der stereotypischen Barbie investieren als die fünf dieses Jahr tatsächlich nominierten Schauspielerinnen. Kurz und gut: Die waren handwerklich einfach einen Ticken mutiger und besser. Was übrigens auch auf den eingangs erwähnten Ryan Gosling in der Rolle des Ken zutrifft. Als üblicherweise waschbrettbäuchiger Beau und wahlweise harter oder zarter Leading Man nuanciert in die Rolle eines ziemlich einfach gestrickten Sidekicks zu schlüpfen, ist schon großes Kino. Und eine kleine, feine Notiz am Rande: Die oft wegen des offenen Jugendwahns in Hollywood bemängelte Praxis, Schauspielerinnen jenseits der Vierzig auf Abstellgleis zu schieben, wird im zwei Mal nominierten Nyad Lügen gestraft. Annette Bening (65) und Jodie Foster (61) geben sich hier in Schwimmkleidung ein völlig natürliches Stelldichein und spielen als nominierte Haupt- bzw. Nebendarstellerin so manches junge Pupperl an die Wand. Just saying.

Das oft angeführte Argument, acht Oscar-Nominierungen für den finanziell erfolgreichsten Film des Jahres stehen in keinem Verhältnis zu dem für 13 Nominierungen dritteinträglichsten Film des Jahres ‚Oppenheimer‘ ist völliger Quatsch.
Ein Funken Wahrheit
Letztlich muss aber auch ich alter, weißer Mann dem „Snub! Snub!“ Gemotze in einer Sache recht geben. Denn Greta Gerwig nicht als Best Director zu nominieren, den guten, alten Scorsese Martin für sein Epos „Killers of the Flower Moon“ aber schon, ist völlig unbegreiflich. Denn so wichtig und richtig dieser Film rund um die abscheuliche Ausbeutung der Ureinwohner der USA in der Pionierzeit auch ist, es ist gänzlich uninspiriertes More-Of-The-Same des Altmeisters. Klar holt er wie immer aus Leo das Maximum heraus, dirigiert die bis dahin kaum bekannte Lily Gladstone vom Stamm der Blackfeet zum wahrscheinlich ersten Oscar für eine indigene Schauspielerin (mark my words!) und setzt natürlich auch seinen zugkräftigen alten Spezl Robert de Niro vor die Kamera. Aber das alles zu routiniert, zu sehr – wenn auch handwerklich einwandfrei – Malen nach Zahlen. Im Gegensatz zur sensationell erfrischenden Art, in der Gerwig ihre rosarote Vision umsetzt und dabei nicht nur Ryan Gosling, sondern auch America Ferrera zu höchst mitreißenden Performances motiviert. Eine Entscheidung, die gänzlich unverständlich ist und auch mich dann, trotz der abzusehenden Übermacht von „Oppenheimer“ in der Oscarnacht ein wenig für „Barbie“ leise weinen lässt.
„Barbie“, der erfolgreichste Kinofilm des Jahres 2023, hat acht Oscar-Nominierungen erhalten, darunter u.a. als Bester Film. Die Tatsache, dass ausgerechnet Schauspieler Ryan Gosling für seine Rolle als Ken nominiert wurde, Schauspielerin Margot Robbie als Barbie jedoch nicht, sorgt für Diskussionsstoff. Warum Greta Gerwig nicht für die Beste Regie nominiert wurde, wird außerdem heiß besprochen.